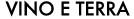31 Jan. 2016
Live Wine in Mailand & ein bisschen mehr
Nach ausgedehntem Winterschlaf stehen im Frühjahr Verkostungen im größeren und kleineren Rahmen an.
Im kleineren Rahmen und für all jene die rund um und in Wien wohnen, sei kurz darauf hingewiesen, dass man sowohl in der Weinhandlung Rudolf Polifka /Reindorfgasse 22, Wien 15 (Do./Fr.) wie auch bei vino nudo/Westbahnstraße 30, Wien 7, Woche für Woche beste Weine auch trinken/kosten & kaufen kann.
Wer weite Wege nicht scheut, kann sich aber auch auf den Weg nach Mailand machen. Dort findet in einem alten Eispalast vom 5.-7. März die Live Wine statt und fast alle, die in Italien exzellente, unverfälschte & authentische Weine keltern, sind dort am Start.
Eine Woche später (12./13.3.) findet in Köln zum zweiten Mal der Wein Salon Natürel statt. Insgesamt eine wenig kleiner, sind die Intentionen ebenso unverfälscht wie in Mailand, der Schwerpunkt wird sich allerdings von italienischen zu französischen Weinabuern verlagern.
Die wichtigste Woche im italienischen Weinkalender (allerdings auch mit vielen internationalen Produzenten) liegt zwischen dem 8. und 13. April, wenn sich zwischen Cerea (Viniveri), Vicenza (Vinnatur) und Verona (Vivit – anlässlich der Vinitaly) gleich drei Messen dezidiert dem Thema Naturwein widmen. Lohnen tun sich alle drei – die beste, weil entspannteste Veranstaltung, findet in Cerea statt.
Wer wissen will, was sich in Frankreich tut (immer viel), kann sich bestens bei vinsnaturel informieren.
18 Jan. 2016
Tocai auf der Maische
Ein Grund, warum auf der Maische vergorene Weißweine (vulgo Oräntschwains) so richtig Spaß machen können, ist der, dass sie Rebsorten ins Rampenlicht rücken, die davor ein paar Lichtjahre davon entfernt standen. Malvasia beispielsweise und Grauburgunder und für Traminer aller Art sollte man eine Maischestandzeit überhaupt verpflichtend einführen.
Schaut man über die Kärntner Grenzen ins Friaul & nach Slowenien gibt es noch ein paar Sorten mehr, die weiß so interessant sind wie eine Kricketmatch, orange jedoch adäquate Begleiter durch eine Arsenalpartie abgeben würden.
Tokaj Friulano beispielsweise, der aber – den Raunzerei der Ungarn sei Dank – heute nicht mehr so heißen darf. Wobei schon Goethe mit ihm anstieß und man erstmal das Ungarische mit dem Italienischen verwechseln muss – aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, weshalb die EU eine ihre essentiellsten Entscheidungen zugunsten der Ungarn gefällt hat.
Egal. Jetzt heißt der Tokaj eben nur noch Friulano oder manchmal auch Jakot, was von rechts nach links gelesen wiederum Tokaj ergibt (sollte sich die Einwohner des Veltlins, die Veltliner, irgendwann durchringen und gegen die Verwechslungsgefahr mit dem Grünen Veltliner klagen, wären die adaptierten Lösungsvarianten entweder VG oder Reniltlev Renürg oder eben Weinviertel DAC – in Österreich denkt man voraus).
Jakot/Friulano/T…i ist in seiner weißen Variante in den meisten Fällen ein mittelgewichtiger Langweiler, der immerhin Kräutern den Vorzug gegenüber allzu viel Frucht gibt. Das passt ganz gut zu Fisch und sitzt man gerade in Grado und hat nichts Besseres zu tun, macht man nichts falsch, wenn man beides kombiniert. Man könnte freilich auch ins Auto steigen und zu Stanko Radikon, Dario Princic, Franco Terpin, Aleks Klinec, Ronco Severo oder Nando aufbrechen und Jakot probieren, wie ihn reife, mazerierte, spontan vergorene bisweilen auf der Maische vergorene Trauben ergeben, die sich über Jahre im Holzfass ausbalanciert und Aromen akkumuliert haben, in denen sich zwar auch ein paar Kräuter aber auch erdige, fruchtige, fleischige und jedenfalls & immer immens saftige Noten gefunden haben.Hat man solche erstmal probiert, ist die Idee mit dem Fisch in Grado allerdings für immer gestorben.
Mazerierte Jakot haben nichts mit ihren weißen Brüdern zu tun und dringen in Welten vor, die davor eben ein paar Lichtjahre entfernt lagen. Abgesehen von ihrer Farbe stellen sie auch in punkto Gerbstoff, Säure, Aromen, Dichte, Lebendigkeit und Lebensdauer jeweils positive Kontrapunkte dar und wer bisher die Finger davon gelassen hat, sollte das schleunigst nachholen. Fulminant waren in den letzten Wochen vor allem der Jakot von Stanko Radikon(Friaul) – trotz seiner 8-jährigen Ausbauzeit lebendig, jugendlich und frisch wie der Charakter des Winzers und der Jakot von Aleks Klinec (Slowenien), der – substantiell, kraftvoll, dicht & engmaschig – zwar gerbstoffmäßig keine Kompromisse eingeht aber auch nicht für Kinder gekeltert wurde.
DIE WEINE
Elisabetta Foradori bewirtschaftet insgesamt 14 Parzellen, wobei anfangs jede einzeln vinifiziert wird. Der Ausbau erfolgt in Stahl, Zement oder Holz undist in seinen Grundzügen für alle Weine gleich: es wird spontan und ohne Temperaturkontrolle vergoren, danach übernimmt die Zeit. Die Weine liegen, je nach Intention, zwischen 12 Monaten und 15 Monaten in ihren Gebinden, danach wird unfiltriert und mit einer marginalen Dosis an Sulfiten (zwischen 20 & 35 mg Gesamtschwefel) abgefüllt.
Der größte Teil fließt in den einfach TEROLDEGO (Ausbau in Zement & Holz) genannten Wein, eine saftige, temperamentvolle, animierende und doch tiefe und substantielle Variante der Sorte – ein Einstiegswein der besonderen Art. Der Rest geht in den Granato (Ausbau im Holz), einen der großen Klassiker der italienischen Rotweinwelt. Profund, dicht, beharrlich, komplex und langlebig – wobei er gerade in kühlen Jahren die besten Ergebnisse zeitigt, da in warmen Jahren die Konzentration und Kraft bisweilen den Trinkfluss hemmt. Der Incrocio Manzoni wird nach einer kurzen Mazeration im Akazienfass ausgebaut, Zitrus & Kräuteraromen verbinden sich mit einem geradlinigen, nie ausladenden Körper, dem ein paar Jahre Flaschenreife immer wieder erstaunlich neue sensorische Dimensionen verleihen.
Fontanasanta (Nosiola)
Dichtung: Ein Wein der Luft braucht und zwar viel. Ähnliches lässt sich über die Zeit sagen. Ein paar Jahre Geduld und man hat einen der besten Weißweine Italiens im Glas (oder ein paar Stunden in der Karaffe) – weiße Blüten, filigran und wirklich komplex. Nasse Steine, ein Andeutung von Steinobst und Rauch, am Gaumen geht es anspielungsreich und detailliert weiter, Kräuter gesellen sich dazu, fantastischer Trinkfluss, nie ausladend, lang, elegant, strukturiert.
Wahrheit: Nosiola ist seit jeher im Trentino beheimatet. Die vielleicht brillanteste Interpretation der Sorte liefert Elisabetta F. mit ihrem, in der Amphore ausgebauten, Fontansanta. Letztere ist die zwei Hektar große Lage in der sich Elisabettas Nosiola befindet, der Boden ist karg und kalkig, die Rebstöcke sind nicht mehr die jüngsten. Wie Zeugnisse der Vergangenheit belegen, wurde Nosiola immer wieder auf den Schalen vergoren. Elisabetta macht das auch und geht mit dem Ausbau in der Amphore noch einen Schritt weiter. Dabei findet über acht Monate eine extrem langsame und feine Auslaugung der Traubenhäute statt, die zudem in völlig reduktivem Milieu abläuft. Der Wein braucht deshalb in jungen Jahren viel Luft und eignet sich nebenbei blendend für jahrelange Kellerreife.
Sgarzon (Teroldego)
Dichtung: Präzise, puristisch und nuanciert. Intensive aber frische rote Frucht, danach wird es komplexer: Gewürze, Pfeffer vor allem, und eine schon in der Nase belebende Frische. Kein Gramm Speck an den Hüften. Knackig, elegant, strukturiert, streng (in einem sehr positiven Sinne). Belebend und bekömmlich – verlangt definitiv nach mehr als nur einer Flasche. Auch weil er sich fortlaufend entwickelt; im Glas und in der Flasche.
Wahrheit: Elisabettas Teroldego ist Legende. In der Zwischenzeit gibt es dankenswerterweise gleich vier davon, Sgarzon und Morei sind dabei Wiederauflagen schon einst produzierter Einzellagen allerdings mit neuem Gesicht. Sgarzon ist eine kühle Lage, dort, wo das Campo Rotaliano langsam in den alpinen Bereich des Val di Non übergeht. 2,5 Hektar hat Elisabetta dort stehen, die Böden sind sandig und von Schwemmland geprägt, die Rebstöcke eng gesetzt (6000/ha) und nicht mehr jung. Der Ausbau des Sgarzon findet in der Amphore statt, ganze 8 Monate reift er interventionsfrei in spanischen Tinajas. Wie schon mehrfach erwähnt, brauchen konsequent produzierte Amphorenweine Zeit und/oder Luft, wer es eilig hat, sollte unbedingt dekantieren.
Morei (Teroldego)
Dichtung: Morei = moro = die dunkle, in dem Fall die Farbe des Teroldego, zumindest der Traube, der Wein ist eher ein filigranes, transparentes rot und Filigranität und Transparenz sind dann wiederum Eigenschaften eines Weins, der dem Begriff Eleganz eine neue Dimension verleiht. Erdigkeit vermag das nicht im Geringsten zu stören, vielmehr entwickelt sich daraus ein feiner puristischer Duft. Will man das Spiel der Kontinuitäten fortsetzen, dann kann man die puristische Karte gleich wieder am Gaumen spüren, das Tannin packt an, gibt dem Morei die richtige Form, die Frucht ist ziseliert und präzis, die Länge lang und die Textur dicht und kompakt.
Wahrheit: Die beiden Teroldego Einzellagen sind letztendlich die Frucht jahrelanger intensiver und akribischer biodynamischer Weingartenarbeit, die sich nun in all ihren Details in den beiden Weinen spiegelt. Jahrelang war auch die Beschäftigung mit den spanischen Tinajas ehe sie die darin vinifizierten Weine auch abfüllte. So leicht ist es nicht mit einem exakten Verständnis der Amphoren, doch weiß man erstmal wie es geht, ergeben sich vielfältige Vorteile. Man hat ein völlig neutrales Gefäß zur Verfügung, das Material ist zudem organisch und mit der Erde verbunden und durch den direkten Kontakt mit der Schale kommt es zu einer feinen, sehr langsamen Mazeration, die zudem maximalen Schutz vor Oxidation bietet. Das Fazit ist mehr als beeindruckend: ein mineralisches und puristisches Spiegelbild eines idealen Teroldego-Terroirs, interpretiert von einer ganz großen Winzerin.