 Die Geschichte von Montesecondo, dem Weingut von Silvio Messana, reicht ins Jahr 1963 zurück. Damals beschloss sein Vater, seinen Besitzungen in Tunesien, wo die Familie damals lebte, noch ein Weingut in der Toskana anzuhängen. Land in den Ausläufern des Chianti Classico war damals günstig. Der Toskana-Tourismus ließ noch ein paar Jahre auf sich warten und mit dem Wein, den man damals produzierte – und meist an die Genossenschaften ablieferte – wurde man auch nicht reich. Silvios Vater setzte dennoch Reben in die Erde, seine Idee in der Toskana Wein zu produzieren, konnte er allerdings nicht umsetzen. Er starb zu früh.
Die Geschichte von Montesecondo, dem Weingut von Silvio Messana, reicht ins Jahr 1963 zurück. Damals beschloss sein Vater, seinen Besitzungen in Tunesien, wo die Familie damals lebte, noch ein Weingut in der Toskana anzuhängen. Land in den Ausläufern des Chianti Classico war damals günstig. Der Toskana-Tourismus ließ noch ein paar Jahre auf sich warten und mit dem Wein, den man damals produzierte – und meist an die Genossenschaften ablieferte – wurde man auch nicht reich. Silvios Vater setzte dennoch Reben in die Erde, seine Idee in der Toskana Wein zu produzieren, konnte er allerdings nicht umsetzen. Er starb zu früh.
Nachdem Silvio damals in Florenz studierte und der Großteil der Familie weiterhin in Tunesien lebte, blieb ihm nichts anderes übrig, als die Geschäfte fürs erste selbst zu übernehmen. Lust darauf hatte er wenig. Er versuchte das Weingut zu verkaufen. Das funktionierte allerdings nicht wie gewünscht, doch fand er immerhin jemanden, der für ihn die Weingarten bewirtschaftete. So konnte er sich für die nächsten 15 Jahre nach New York verabschieden, wo er zum einen als Musiker zum anderen aber auch als Weinhändler arbeitete.
BIODYNAMIK
Im Jahr 2000 zog er einen Schlussstrich unter Amerika und kehrte in die Toskana zurück. Er hatte, pünktlich zum Jahrtausendwechsel, beschlossen Winzer werden. Die ersten beiden Jahre sammelte er Erfahrungen. Er sprach mit Winzern der Umgebung, pflanzte – wie das damals üblich war – Cabernet Sauvignon neben die schon vorhandenen Sangiovese, Canaiolo und Colorino und kaufte sich sukzessive einen kleinen Keller zusammen. Die große Zäsur fand im Jahr 2003 statt. Der konventionellen Landwirtschaft nicht nur überdrüssig, sondern auch gesundheitlich von ihr angegriffen, besuchte er ein Seminar von Nicolas Jolys über biodynamischen Weinbau in Bologna. Wieder zu Hause angekommen, entsorgte er seinen Giftschrank und startete umgehend mit der Demeter Zertifizierung.
In den nächsten 10 Jahren folgte dann ein Schritt auf den nächsten: dabei wurde ihm der Einfluss seines Terroirs immer deutlicher bewusst und die Notwendigkeit es so präzis wie möglich in Wein zu übersetzen. Der Blick zurück in die Geschichte des Chianti Classico gewann folglich ebenso an Bedeutung wie die Erkenntnis seinen Weinen im Keller die Freiheit zu lassen, die sie brauchten, um ihr Potenzial auf den Punkt zu bringen.
CHIANTI WIRKLICH CLASSICO
Er setzte auf klassische Alberello-Erziehung in den Weingärten, spontane Vergärung im Keller und den Ausbau in Zement und Holzbottichen. Er fuhr den Schwefeleinsatz zurück, vertraute auf die natürliche Klärung der Moste und filterte nicht mehr. Und schaffte es damit sukzessive, seinen Weinen immer mehr Identität und Individualität zu verleihen.
Silvios Weine haben mit den meisten zeitgenössischen Versionen, die man aus der Gegend kennt, wenig zu tun. Es sind radikale Gegenentwürfe zu einer verfehlten Vorstellung dessen, was Chianti heute definiert. Den weichgespülten, braven und von internationalen Rebsorten geprägten Versionen vieler Winzer, setzt er Interpretationen entgegen, die puristisch, kühl und geradlinig mit jeder Gefälligkeit dem Chianti-Konsortium gegenüber kompromisslos aufräumen und gerade deswegen dem Konsumenten wieder Trinkfluss und – wenn man sich darauf einlässt – auch Authentizität bescheren.
Silvios Chianti Classico (2015) entsteht aus Sangiovese, Canaiolo und Colorino und wird teils in großen Holzfässern, teils in Zement ausgebaut: er trägt seine Blässe mit Würde, auch deswegen, weil er weiß, dass es nicht um Äußerlichkeiten geht. Erde, Laub und frische rote Fruchtaromen prägen das Aromaprofil, Dynamik, Energie und Vitalität den Gaumen. Die Struktur ist gebündelt und druckvoll, dabei allerdings nie streng. Eleganz weist den Weg.
Dem Chianti Classico zur Seite steht der Montesecondo (2015), ein reinsortiger Sangiovese, der zur Gänze in Zement ausgebaut wird. Klar, geradlinig, feingestrickt und lebhaft zeigt er, dass Sangiovese auch im Basisbereich blendend funktioniert und keine Verstärkung von Cabernet & Co. braucht.
Der Cabernet, den er Anfang der 2000er ausgesetzt hat, spielt die Hauptrolle im Rospo (2014): im Zement ausgebaut setzt er einen Kontrapunkt zu quasi allen Cabernets, die mir je untergekommen sind. Elegant, zurückhaltend und fruchtpräzis schafft er es völlig eigenständige Aroma- und Texturwelten für sich zu reklamieren. Bleibt der TÏN (2013), Silvios Opus Magnum: über 10 Monate in der Amphore ausgebaut ist er die Quintessenz dessen, was Sangiovese im nördlichen Chianti Classico zu leisten und zu repräsentieren vermag. Er ist pulsierend und animierend und dabei doch profund und gehaltvoll. Er ist luftig und zart und dabei doch vollmundig und saftig. Er hat Trinkfluss und doch Aura. Seine Aromen spannen Bögen, die sowohl Frucht wie auch Erdnoten Platz einräumen und sich wohl mit der Zeit noch wandeln werden.
Zu guter Letzt vinifiziert Silvio auch noch einen weißen TÏN: Die Basis bildet Trebbiano toscano und wie schon das rote Pendant wird auch hier in der Amphore vergoren und ausgebaut. Das Ergebnis ist ähnlich spektakulär. Nach 6 Monaten auf den Schalen hat der TÏN bianco (2014) eine einladende , vibrierende und saftige Textur, enormen Zug und eine gebündelte, gelbfruchtige Direktheit, die sich durch den Mund bis zum Gaumen zieht. Steinige und feinkräutrige Aromen sorgen für zusätzliche Komplexität, eine ausgewogene Säure- und Gerbstoffachse liefern Struktur und gleichzeitig die Garantie für ein langes Leben.
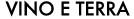






 Die Geschichte von Montesecondo, dem Weingut von Silvio Messana, reicht ins Jahr 1963 zurück. Damals beschloss sein Vater, seinen Besitzungen in Tunesien, wo die Familie damals lebte, noch ein Weingut in der Toskana anzuhängen. Land in den Ausläufern des Chianti Classico war damals günstig. Der Toskana-Tourismus ließ noch ein paar Jahre auf sich warten und mit dem Wein, den man damals produzierte – und meist an die Genossenschaften ablieferte – wurde man auch nicht reich. Silvios Vater setzte dennoch Reben in die Erde, seine Idee in der Toskana Wein zu produzieren, konnte er allerdings nicht umsetzen. Er starb zu früh.
Die Geschichte von Montesecondo, dem Weingut von Silvio Messana, reicht ins Jahr 1963 zurück. Damals beschloss sein Vater, seinen Besitzungen in Tunesien, wo die Familie damals lebte, noch ein Weingut in der Toskana anzuhängen. Land in den Ausläufern des Chianti Classico war damals günstig. Der Toskana-Tourismus ließ noch ein paar Jahre auf sich warten und mit dem Wein, den man damals produzierte – und meist an die Genossenschaften ablieferte – wurde man auch nicht reich. Silvios Vater setzte dennoch Reben in die Erde, seine Idee in der Toskana Wein zu produzieren, konnte er allerdings nicht umsetzen. Er starb zu früh.


