Claudio Plessi ist eine der großen Figuren im biologischen Weinbau der Emilia. Das wissen selbst in der Emilia die wenigsten, was vor allem daran liegt, dass Claudio zwar seit den 70er Jahren immer wieder große Projekte initiiert, sich dabei aber selbst weitgehend zurücknimmt. Folglich sind wir uns erst vor kurzem bei einer dem Lambrusco gewidmeten Verkostung in Vignola erstmals über den Weg gelaufen, wo er eine Handvoll sprudelnder Weine ausschenkte, die sich nicht nur qualitativ von denjenigen der anderen unterschieden. Auch was er einschenkte, sprengte den üblichen Kanon.
Wir starteten mit dem Ruzninteina, einem reinsortigen Ruggine, zu Deutsch „Rost“, einer alten Sorte aus dem Modenese, die ihren Namen ihrer tieforangen Farbe verdankt und nach Trockenfrüchten, Heu und Hefe schmeckt; machten mit dem Sparglàta, einem 100%igen Spergola weiter und krönten die erste Runde mit dem Tarbianein, seinem brillanten, ein wenig barocken, duftigen und mundfüllenden Trebbiano di Spagna.
Zwar pflegt Claudio – wie es sich für die Gegend gehört – die Tradition moussierender Weine, doch belässt er es bei all seinen Weinen bei einem feinen Prickeln, das zwar, ähnlich dezent wie der Winzer, im Hintergrund für Struktur sorgt, anderen Attributen (Aroma, Säure & Textur) allerdings die Bühne überlässt.
Die zweite Runde läutete Claudio mit dem Tàsca Rosato ein. In Rebsorten übersetzt bedeutet das Uva Tosca, in Aromen Kirschen und Unterholz. Uva Tosca ist eine seit ein paar hundert Jahren im emilianischen Apennin beheimatete Sorte, die sich kälte- und frostresistent bis auf 700 Meter hinaufzieht und filigrane, unbeschwerte und aromatisch subtile Weine ergibt, vorausgesetzt man keltert sie so wie Claudio (Vittorio Grazianos exzellenter Smilzo ist ein weiteres Beispiel). Danach wurde es dunkelrot und das heißt in dieser Ecke Italiens Lambrusco grasparossa, die intensivste, kräftigste und forderndste der vielen Lambruscovarianten. Claudios Interpretation macht diesbezüglich keine Ausnahme. Das Tannin ist präsent aber fein, die Aromen sind dunkel (Beeren, Balsam, Erde) und die Struktur ist klar und animierend. Der Wein heißt übrigens Tiepido, eine Referenz an den kleinen Bach, der an seinem Weingarten in Castelnuovo Rangone vorbeifließt und dafür mitverantwortlich ist, dass Claudio auch in den heißesten aller Sommer (2017) nicht bewässert.
Die dritte Runde nahmen wir dann bei Flavio Cantelli in Angriff, dem Eigentümer des Weinguts Maria Bortolotti. Claudio und Flavio bilden eine Art Winzerkollektiv, wobei sie nicht nur die gleichen Ideen vertreten (beide haben die Carta degli intenti dei Vignaioli Arigianali Naturali unterzeichnet), sondern sich auch einen Keller teilen. Was sich allerdings unterscheidet sind die Rebsorten und die Region. Flavios Weingut in Zola Pedrosa befindet sich zwar nur 15 Kilometer von Claudios Weingarten entfernt, doch ist man dort bereits in den Colli Bolognesi und folglich in einer zwar topographisch ähnlichen, ampelographisch allerdings völlig anderen Welt. Flavios wichtigste Sorte ist Pignoletto und statt Lambrusco und Uva Tosca hat er Barbera, der in den bolognesischen Hügeln bereits seit dem 12. Jahrhundert dokumentiert ist und aus dem er einen der besten Rotweine der Emilia keltert – doch davon ein andermal.
Die dritte Runde eröffnete Claudio mit dem Tarbian, seines Zeichens Trebbiano modenese und einer seiner allerbesten und den ausnahmslos sehr guten Weinen. Der Tarbian bleibt als einziger Weißwein für ein paar Tage auf der Maische (Claudio meint, die Sorte verlange danach), was ihm – laut Claudio – zusätzlich Struktur, Substanz und Aromen gibt. Er ist weich und rund, mit einer feinen Perlage und einem Aromaprofil, das Platz für Blüten, Zitrusfrüchte, Salz und Hefe lässt. Unter all den raren Sorten, die wir sukzessive durchprobieren, ist dann auch eine dabei, die noch rarer ist, als alle anderen zuvor und von der Claudio meint, dass er wohl weltweit der Einzige wäre, der sie vinifizieren würde. Der Caveriòl ist zu 100% Festasio, Rot und elegant, mit feinen Tanninen, milder Perlage, reifer roter Frucht und, wie so oft bei ihm, einem erdigen Unterton. Das letzte Wort in der dritten Runde gehört aufs Neue einem Lambrusco: diesmal der Spielart aus Fiorano, dem Ort, wo von Zeit zu Zeit Formel I Boliden die Weingärten beschallen. Der Lambruscaun ist dunkel und fleischig, ein wenig bitter und vielleicht der einzige unter Claudios Weinen, der in einer Cuvèe besser aufgehoben wäre. Doch das widerspräche seiner Idee, die Bandbreite und den Charakter marginalisierter Rebsorten aufzuzeigen – wie eigenwillig sie auch bisweilen sein mögen..
Die vierte Runde trugen wir vor kurzem in Claudios Weingarten aus – zwischen dunklen, reifen Trauben und ganz ohne Wein. Dafür erzählte mir Claudio von seinem Leben als Winzer, dass 1958 als Sechsjähriger begann, als seine Eltern einen ersten Weingarten (Belussi) kauften und er in der Bütte mit den Füßen über die Beeren stampfte. Damals verkaufte man den Großteil der Trauben noch an die Genossenschaft in Settecani und kelterte aus dem Rest Flaschen für den Hausgebrauch.
Mit 18 verabschiedete er sich fürs erste vom tagtäglichen Landleben, studierte in Reggio Emilia Landwirtschaft und forschte danach in Parma und Piacenza weiter. Nicht nur über Wein, sondern auch über alte Olivenarten in der Emilia (die ihn bis heute intensiv beschäftigen), autochthone Kirschensorten und über Hühnerrassen rund um Modena. Daneben blieb noch ausreichend Zeit um sich politisch dort zu positionieren, wo das Herz schlägt, aktiv in der Arbeiteravantgarde mitzuarbeiten und Präsident des Radio Cooperativa Modenese, einem Piratensender zu werden. Bereits als Professor für Landwirtschaft wurde er einer der Vorreiter der biologischen Bewegung der emilia und war 1987 einer der Gründerväter von Il Salto, einem Konsortium biologisch und biodynamisch produzierender Landwirte.
1986 übernahm er den 1958 gepflanzten Hektar, 2004 pflanzte er dann in die Ebene rund um sein Elternhaus 3,5 Hektar mit jenen Reben, die heute das Fundament für seine einmalige Serie an Schaumweinen bilden. Sämtliche Reben stehen in der Ebene, auf einem Gemisch aus Ton und Kalk, über das sich eine feine Sandschicht gelegt hat. Zwischen den Rebzeilen wächst, was wachsen will, gewipfelt wird grundsätzlich nicht, das gelegentliche Zuviel an Blätter entfernt er manuell. Die Lese ist für emilianische Verhältnisse spät, doch weiß er um die Qualität und Resistenz seiner Trauben.
Im Keller läuft alles nach eingespielten Regeln ab. Die Weine werden, je nach Sorte, gar nicht, kurz oder etwas länger mazeriert, spontan vergoren und ohne Temperaturkontrolle in Stahltanks ausgebaut. Gefiltert wird nicht, geschwefelt schon (ca. 30mg/l) Die Zweitgärung findet in der Flasche statt, degorgiert wird nicht.
Claudios Mission ist noch nicht zu Ende. In den letzten Jahren pflanzte er noch eine weitere Sorten aus (Grappello), mit der er demnächst sein ohnehin schon imposantes Sortiment weiter vergrößern wird. Einer fünften Runde steht also nichts im Wege.
Ps: Claudio Plessi tritt seit kurzem auch gelegentlich öffentlich in Erscheinung: beispielsweise schenkt er seine Weine bei der großen Kulturweinverkostung in Fornovo und bei den Zusammenkünften von Emilia sur li aus und wer weiß, vielleicht wird es seine Weine auch irgendwann im deutschsprachigen Raum zu kaufen geben. Lohnen würde es sich allemal.
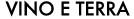

 Pignoletto erinnert in vielerlei Hinsicht an Welschriesling. Multifunktional und anspruchslos keltern 98% der Winzer daraus uninteressante und belanglose Weine, deren einzige Vorteile darin bestehen, dass sie billig sind. Pignoletto wie auch Welschriesling dienen als Basis für simple Stillweine, simple Schaumweine und simple Süßweine. Doch immer dann, wenn man glaubt, mit der Sorte endgültig abgeschlossen zu haben, melden sich die 2% zu Wort. Judith Beck beispielsweise mit ihrem Welschriesling Bambule oder aber Flavio Cantelli und Antonio Ognibene mit gleich mehreren exzellenten Pignolettoversionen.
Pignoletto erinnert in vielerlei Hinsicht an Welschriesling. Multifunktional und anspruchslos keltern 98% der Winzer daraus uninteressante und belanglose Weine, deren einzige Vorteile darin bestehen, dass sie billig sind. Pignoletto wie auch Welschriesling dienen als Basis für simple Stillweine, simple Schaumweine und simple Süßweine. Doch immer dann, wenn man glaubt, mit der Sorte endgültig abgeschlossen zu haben, melden sich die 2% zu Wort. Judith Beck beispielsweise mit ihrem Welschriesling Bambule oder aber Flavio Cantelli und Antonio Ognibene mit gleich mehreren exzellenten Pignolettoversionen.















